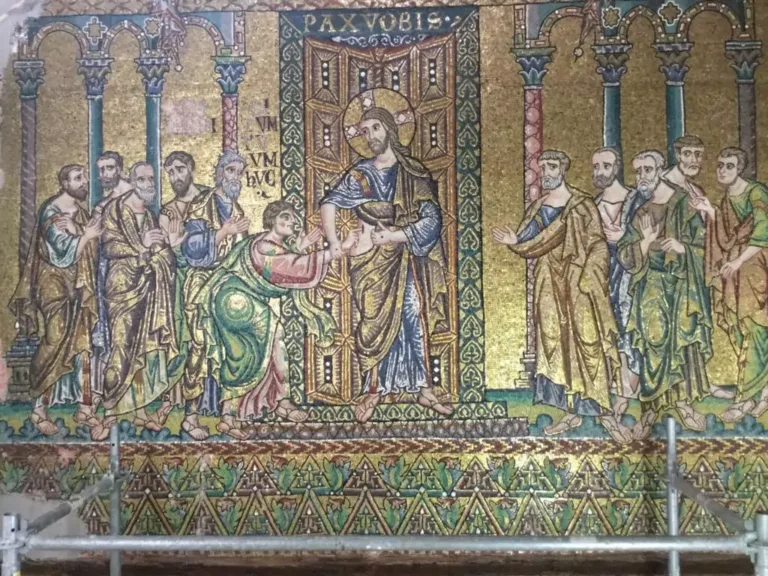KIRCHE IN NOT sieht angesichts der anhaltenden Krisenlage im Nahen Osten die Gefahr einer weiteren Auswanderungswelle der christlichen Gemeinschaften. Mit zahlreichen Hilfsprojekten versucht unser Hilfswerk dem entgegenzusteuern.
„90 Prozent der syrischen Bevölkerung denkt ans Auswandern“, berichtet etwa Basilios Gergeos von der melkitisch-katholischen Pfarrei St. Joseph in der Hauptstadt Damaskus. Sowohl Muslime als auch Christen verlassen das Land. Allerdings ist die Zahl der syrischen Christen ohnehin schon so gering, dass die Präsenz des Christentums im Land generell infrage gestellt ist. Aktuellen Schätzungen zufolge leben nur noch um die 175 000 christliche Familien im Land – und der Auswanderungsstrom reißt nicht ab.
Schwester Annie Demerjian von der Kongregation der „Schwestern Jesu und Mariens“ und langjährige Projektpartnerin von KIRCHE IN NOT ist wütend über die Situation: „Nach 13 Jahren Leid haben viele Menschen die Hoffnung verloren. Manche sagen sogar, dass es ihnen während des Kriegs noch besser ging als heute. Das ist schrecklich.“ Die Entwicklung sei an einem entscheidenden Punkt angekommen: „Entweder wir geben den verbleidenden Christen eine Perspektive oder sie gehen alle.“

Auch im Nachbarland Libanon wandern so viele Menschen aus, dass die Behörden bereits 2022 die Ausgabe von Reisedokumenten gestoppt haben. Damals war die Zahl der Passanträge auf über 8000 pro Tag angestiegen. Besonders Christen, die sehr gut ausgebildet sind, verlassen das Land. Aktuell herrscht im Libanon große Angst vor einer Ausweitung des Gaza-Kriegs, was den Druck zur Auswanderung noch verstärkt.
KIRCHE IN NOT steht den lokalen Gemeinden bei, um den Christen vor Ort zu helfen und sie dadurch zum Bleiben zu bewegen. In der Pfarre von Basilios Gergeos in Damaskus zum Beispiel unterstützt das Hilfswerk eine psychiatrische Tagesklinik, einen Kindergarten, eine Suppenküche und die Verteilung von Milch an Kinder mit Mangelerscheinungen. Die Pfarre erhält auch Spenden, um Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche durchzuführen oder für die Arbeit von Pfadfindergruppen.

Da vor allem junge Menschen häufig eine bessere Zukunft im Ausland suchen, unterstützt KIRCHE IN NOT die Arbeit nahezu aller kirchlichen Schulen und Bildungseinrichtungen und zahlt Stipendien für die Ausbildungskosten.
Von großer Bedeutung sind auch Veranstaltungen wie zum Beispiel die im Jahr 2023 abgehaltenen Jugendtage, die parallel zum Weltjugendtag in Lissabon stattfanden. „Diese Veranstaltungen haben oft zum ersten Mal christliche Jugendliche in Syrien und im Libanon zusammengebracht“, erklärt Xavier Bisits, der zuständige Projektreferent von KIRCHE IN NOT. „Alle jungen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren von dem Gefühl der Einheit und Solidarität tief berührt.“
Viele Christen hätten nach wie vor den Wunsch, in ihrer Heimat bleiben zu können, zeigt sich Pfarrer Basilios Gergeos optimistisch: „Wenn sie ein Dach über dem Kopf und eine Arbeit haben, bleiben sie hier. Es ist schließlich ihre Heimat!“

Von großer Bedeutung ist deshalb die Unterstützung der „Hope Center“, die es mittlerweile in Damaskus und Aleppo gibt. Christliche Familien erhalten dort Kleinkredite und weitere Unterstützung, um einen kleinen Handwerksbetrieb, einen Laden oder eine andere Geschäftsidee auf die Beine zu stellen. KIRCHE IN NOT unterstützt diese innovativen Projekte seit einigen Jahren. Ein Mitarbeiter des Hope Centers, Garabed Avedisian, erklärte gegenüber KIRCHE IN NOT: „Mit diesen Projekten bauen wir nicht nur unser Land auf, sondern auch unser Zuhause.“
Empfänger: KIRCHE IN NOT
IBAN: AT71 2011 1827 6701 0600
Verwendungszweck: Naher Osten
Knapp acht Monate nach den verheerenden Angriffen auf Christen in der nordpakistanischen Stadt Jaranwala, bei denen mehr als 20 Kirchen in Brand gesteckt und über 100 Häuser zerstört worden waren, sieht der katholische Bischof von Faisalabad, Indrias Rehmat, keine Anzeichen für eine Aufarbeitung oder Wiedergutmachung seitens des Staates.
Im Gespräch mit KIRCHE IN NOT sagte Rehmat: „Mehr als 300 mutmaßliche Täter wurden verhaftet, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie vor Gericht gestellt werden. Nach und nach werden sie wieder freigelassen. Niemand wurde angeklagt.“ Der Bischof fügte hinzu: „Wir wollen Gerechtigkeit. Die Schuldigen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, damit dies eine Lehre für andere ist.“

Der Bischof kritisierte außerdem die mangelhaften Instandsetzungsarbeiten seitens der Regierung an drei ausgebrannten Kirchen. Die Kirchengebäude könnten bis heute nicht ohne Gefahr betreten werden. Rehmat berichtete: „Ich habe mir die Reparaturarbeiten der Regierung an beschädigten Gebäuden angesehen, und habe sie dann gebeten, die Arbeiten einzustellen. Sie wollten den Medien zeigen, dass alles in Ordnung sei, aber sie haben nur die Wände getüncht. Ich konnte sogar noch den Rauch riechen. Es ist nicht ratsam, unter diesen Dächern zu beten.“
Positiv bewertete Bischof Rehmat hingegen die Fortschritte der von KIRCHE IN NOT unterstützten Renovierungsarbeiten an 150 von Christen bewohnten Häusern in Jaranwala. In einem weiteren Hilfspaket werden von der Gewalt betroffene Familien zudem Motorräder und Autorikschas erhalten, damit sie einer Arbeit als Taxifahrer oder Kuriere nachgehen können. Bis zu 400 Kinder werden außerdem mit Schulbüchern und Schultaschen ausgestattet.
Der Bischof dankte allen Spendern von KIRCHE IN NOT für Ihre Hilfe: „Wir sind sehr dankbar für diese großartige Unterstützung. Wir alle beten für ‚Kirche in Not‘ und alle Wohltäter.“
Empfänger: KIRCHE IN NOT
IBAN: AT71 2011 1827 6701 0600
Verwendungszweck: Pakistan

Das Auto ist bereits eingetroffen und wurde feierlich eingeweiht. Es erleichtert die pastorale Arbeit immens, denn die Pfarre erstreckt sich über ein weitläufiges Gebiet mit 21 Kapellengemeinden, die bis zu 57 Kilometer vom Sitz der Pfarre entfernt gelegen sind, und die Straßenverhältnisse sind katastrophal. Hier kann man nur mit einem geländegängigen Fahrzeug durchkommen. Pfarrer Leo und seine Gläubigen haben sich riesig gefreut!
Allen, die geholfen haben, ein herzliches Vergelt’s Gott!

Nach 22 Jahren in der Türkei ist Erzbischof Kmetec fest davon überzeugt, dass die Kirche die Pflicht hat, weiterhin in diesem Land präsent zu sein. „Das sind wir Christus schuldig. Wir sind es der Geschichte schuldig. Und wir sind es den Märtyrern schuldig“, sagte der Erzbischof anlässlich seines Besuchs bei KIRCHE IN NOT. Die Stadt Izmir ist der Ort, an dem der heilige Polykarp Mitte des zweiten Jahrhunderts den Märtyrertod erlitt. Sie ist auch der Geburtsort des heiligen Irenäus, Polykarps Schüler und der spätere Bischof von Lyon.
Bei dieser besonderen Mission – die christliche Präsenz in diesem Land der Märtyrer zu erhalten – unterstützt „Kirche in Not“ die Erzdiözese Izmir. Beispielsweise fördert KIRCHE IN NOT die Renovierung der Kirche des heiligen Polykarp, die am 30. Oktober 2020 durch ein Erdbeben in der Ägäis, das Izmir verwüstete und bei dem über hundert Menschen ums Leben kamen, beschädigt wurde. Die Kirche des heiligen Polykarp ist Teil des 1625 von französischen Kapuzinern errichteten Klosters und das Herzstück der christlichen Gemeinde in Izmir. Desgleichen unterstützt das internationale Hilfswerk die Renovierung der Dominikanerkirche in Konak, einem Stadtteil von Izmir; sie wurde ebenfalls durch das Erdbeben im Jahr 2020 beschädigt.

Obwohl sich die Erzdiözese Izmir in Westanatolien über ein Gebiet von rund 100 000 Quadratkilometern erstreckt, sind dort nur 5000 Katholiken beheimatet. Lange machten Levantiner den Großteil der katholischen Gläubigen aus, erklärt Erzbischof Kmetec, der das Erzbistum seit drei Jahren leitet. Diese sind die Nachkommen italienischer, französischer und anderer europäischer Einwanderer, die sich zu Zeiten des Osmanischen Reiches in der Region niedergelassen haben; ihre Zahl geht vor allem aufgrund von Auswanderung kontinuierlich zurück. Dem Erzbischof zufolge wird dieser Rückgang der levantinischen Katholiken in der Erzdiözese seit einigen Jahren jedoch durch die Einwanderung von Katholiken aus Afrika und Asien in die Türkei ausgeglichen.
Angesichts der geringen Anzahl von Katholiken in seiner Erzdiözese sei es eines seiner wichtigsten Anliegen, „das Licht des Christentums lebendig zu halten“. Bei einer so niedrigen Zahl an Gläubigen verfügt die Erzdiözese jedoch nicht über ausreichende Mittel, um all ihre Kirchen und Gebäude selbst zu unterhalten. Daher ist die Unterstützung durch KIRCHE IN NOT überaus wichtig für das Überleben der christlichen Gemeinschaft in der Region und für den Erhalt der christlichen Präsenz in der Türkei – einem für die Geschichte der frühen Kirche so wichtigen Land, in dem die Anhänger Jesu zum ersten Mal Christen genannt wurden.
In den letzten fünf Jahren hat KIRCHE IN NOT in Zusammenarbeit mit der Erzdiözese Izmir zwölf Projekte in einem Umfang von insgesamt 485.000 Euro unterstützt. Zu diesen Projekten gehören die Renovierung von Kirchen, die durch Erdbeben beschädigt wurden, Nothilfe für christliche Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika, das Bereitstellen von katechetischem Material und die Unterstützung der Ausbildung von Seminaristen.
Empfänger: KIRCHE IN NOT
IBAN: AT71 2011 1827 6701 0600
Verwendungszweck: Türkei
Dank Eurer Hilfe konnte in der Diözese Jagdalpur ein Heim für alte und kranke Priester eingerichtet werden. 30.000 Euro kamen dafür zusammen. Wir hatten im Frühling 2022 bereits über die Grundsteinlegung berichtet und freuen uns nun über die Nachricht, dass das Heim fertiggestellt und eingeweiht wurde.
Inzwischen sind dort Priester untergebracht, die viele Jahre lang unermüdlich gearbeitet haben und nun alt oder durch die harten Lebensumstände krank geworden sind. Der Dienst in dieser Diözese ist hart und entbehrungsreich, denn die Priester arbeiten vor allem in den abgelegenen und unterentwickelten Gebieten und müssen weite und beschwerliche Wege zurücklegen. Die alten und kranken Priester können nicht mehr allein in den abgelegenen Dörfern bleiben, sondern müssen medizinisch behandelt werden und brauchen Pflege.

Bischof Joseph Kollamparampil bedankt sich bei allen, die geholfen haben:
„Ich bin sehr, sehr dankbar für die wunderbare Unterstützung, die Sie uns gewährt haben, damit wir ein Heim für die alten und kranken Priester unserer Diözese bauen konnten. Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass das Haus „Schalom“ fertiggestellt wurde und am 7. Juni 2023 eingeweiht wurde. Obwohl wir auf viele Hindernisse stießen, konnten wir dank der Gnade Gottes und harter Arbeit den Bau schneller abschließen, als wir es gedacht hatten. Danke für Ihre stete Hilfe und Ihre Liebe! Wir beten für Sie!“
KIRCHE IN NOT arbeitet dabei eng mit lokalen Schwesterngemeinschaften zusammen, zum Beispiel mit der Kongregation der Schwestern Jesu und Mariens, die sowohl im Syrien als auch im Libanon tätig sind.
Schwester Annie Demerjian berichtet: „Wenn Eltern ihren Kindern eine neue Hose, ein Hemd oder Schuhe kaufen wollen, müssen sie in Syrien aktuell bis zu zwei Monatslöhne dafür ausgeben. Für viele Familien ist deshalb ein neues Kleidungsstück ein Traum.“

Die langjährige Projektpartnerin von KIRCHE IN NOT wird deshalb mit ihren Mitarbeiterinnen auch in diesem Jahr vor Weihnachten warme Winterkleidung an Kinder verteilen. Die Anoraks, Pullover oder Hemden wurden meist von lokalen Herstellern gefertigt, was das Einkommen für zahlreiche Familien sichert.
Im Libanon steht die Weihnachtsaktion dieses Jahr unter dem Motto „Schaffe Freude, wenn du sie nicht finden kannst“. Schwester Raymonda Saade von der Kongregation der Schwestern vom heiligen Josef organisiert dort kleine Weihnachtsfeiern für Familien, bei denen die Kinder ein Präsent erhalten. Dank ihrer umsichtigen Wirtschaftsweise konnten die Schwestern im vergangenen Jahr sogar 1000 Kinder mehr als geplant beschenken.
Der Krieg im Heiligen Land wirft dieses Jahr auch dunkle Schatten auf den benachbarten Libanon. Der Süden des Landes gilt als Hauptstützpunkt der islamistischen Hisbollah; die Sicherheitslage ist dort schon seit Jahren angespannt.

„Trotz dieser schwierigen Situation werden wir auch im Südlibanon an 500 christliche Kinder Geschenke verteilen“, berichtet Schwester Raymonda, verbunden mit dem Dank an die Wohltäter von KIRCHE IN NOT: „Ohne Sie hätten wir nichts erreichen können. Nur dank Ihrer Spenden können wir diesen Traum verwirklichen. Wir sind sicher: Mit jedem verteilten Geschenk, mit jedem Lächeln eines Kindes, bekommen Sie eine besondere Gnade zurück.“
Der Libanon und Syrien leiden unter extremer Inflation und Mangelwirtschaft. UN-Angaben zufolge leben im Libanon rund 70 Prozent der Bevölkerung in extremer Armut, in Syrien sind es 90 Prozent. Dort hat der Krieg zu einem Rückgang der christlichen Bevölkerung um mehr als zwei Drittel geführt, heute leben schätzungsweise unter einer halben Million Christen in Syrien.

Auch im Libanon, das mit schätzungsweise 2,2 Millionen Gläubigen die zahlenmäßig größte christliche Gemeinschaft im Nahen Osten beherbergt, hält der Trend zur Auswanderung weiter an. Vor allem junge Familien verlassen das Land.
Empfänger: KIRCHE IN NOT
IBAN: AT71 2011 1827 6701 0600
Verwendungszweck: Syrien oder Libanon
Am Samstag, 16. Dezember, wurden zwei Frauen auf dem Kirchengelände der katholischen Pfarre „Heilige Familie“ in Gaza-Stadt von Scharfschützen erschossen. Das teilte das Lateinische Patriarchat von Jerusalem in einer Aussendung mit, die KIRCHE IN NOT (ACN) vorliegt. Sieben weitere Personen seien verletzt worden. Am gleichen Tag hätten auch mehrere Raketen das Kloster der „Missionarinnen der Nächstenliebe“ getroffen, in dem sich über 50 Menschen mit Behinderungen aufhielten.
Bei den beiden getöteten Frauen handelt es sich nach Angaben von Projektpartnern von KIRCHE IN NOT um Samar Anton und ihre Mutter Nahida. Beide seien tödlich verletzt worden, als sie sich in einem Pfarreigebäude in Sicherheit bringen wollten.
Das Lateinische Patriarchat gab an, dass es sich bei den Scharfschützen um israelische Militärs gehandelt habe. „Sieben weitere Personen wurden verwundet, als sie andere Menschen auf dem Kirchengelände zu schützen versuchten“, heißt es in der Mitteilung weiter.
Medienberichten vom Samstagabend zufolge rechtfertigte das israelische Militär sein Vorgehen damit, dass angeblich ein Raketenwerfer in der Pfarrei stationiert sei.
Die Gebäude der katholischen Pfarre „Heilige Familie“ in Gaza-Stadt sind am vergangenen Wochenende von Granatsplittern getroffen worden; dabei wurden auf dem Dach befindliche Wassertanks und Solarpaneele zerstört.
Am 12. Dezember sei außerdem auf dem Pfarrgelände eine nicht detonierte Rakete entdeckt worden. Es sei aktuell nicht möglich, diese zu entschärfen, teilten lokale Ansprechpartner KIRCHE IN NOT mit.
Wegen des Treibstoffmangels könne auch der Stromgenerator für die Pfarrgebäude nicht mehr betrieben werden. All das verschlechtert die Situation der Zivilisten, die in den Räumen der einzigen katholischen Pfarre im Gaza-Streifen Zuflucht gefunden haben, unter ihnen auch Kinder und Menschen mit Behinderung.

Lokalen Angaben zufolge sind seit Kriegsausbruch im Gaza-Streifen 22 der rund 1000 im Gaza-Streifen lebenden Christen an den Folgen des Krieges gestorben. 17 von ihnen wurden getötet, als die zur griechisch-orthodoxen Pfarre St. Porphyrius gehörenden Gebäude im Oktober von einer Bombe getroffen wurden. Fünf Christen starben aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung.
„Nach der jüngsten Waffenruhe sind wir in die katholische Pfarre zurückgekehrt, um auf das Ende des Krieges zu warten“, schrieb ein Christ aus Gaza an „Kirche in Not“. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, um unser Überleben in dieser Zeit der Not zu sichern.“ „Kirche in Not“ hat Mittel zur Verfügung gestellt, mit denen die Verantwortlichen der Pfarre „Heilige Familie“ Lebensmittel und Medikamente besorgen konnten.

In Kooperation mit dem Lateinischen Patriarchat von Jerusalem unterstützt KIRCHE IN NOT auch die Arbeit der christlichen Minderheit im Westjordanland und Ostjerusalem sowie Arbeitsmigranten in Israel.
Empfänger: KIRCHE IN NOT
IBAN: AT71 2011 1827 6701 0600
Verwendungszweck: Heiliges Land
KIRCHE IN NOT hat weitere 2,6 Millionen Euro auf den Weg gebracht, um die Arbeit katholischer Schulen in Libanon und Syrien zu unterstützen. Das Hilfspaket umfasst Stipendien für über 16 000 Schüler sowie Gehaltszuschüsse für 6000 Lehrer an rund 180 katholischen Schulen. Darüber hinaus erhalten auch über 170 Religionslehrer, die an staatlichen Schulen arbeiten, einen Zuschuss zu ihrem geringen Gehalt.
Das Hilfsprogramm umfasst auch 20 Projekte zur Installation von Solaranlagen auf kirchlichen Schulen, um diese unabhängiger von steigenden Energiepreisen zu machen. Weitere Hilfsgelder sind vorgesehen, um mittellosen Familien beim Kauf von Heften und Büchern für den Unterricht unter die Arme zu greifen.

Ohne die Unterstützung stünden die katholischen Schulen in Libanon und Syrien vor dem Aus, betont Marielle Boutros, die als Lehrerin arbeitet und dabei hilft, die Projekte von KIRCHE IN NOT vor Ort zu koordinieren: „Unsere katholischen Schulen befinden sich in einem Teufelskreis: Die Eltern können die Schulgebühren nicht mehr bezahlen. Staatliche Unterstützung gibt es keine. Ohne Einnahmen können die Schulen aber den Lehrern keine Gehälter mehr zahlen. Dazu kommen die laufenden Kosten.“
Doch sollten die katholischen Schulen schließen müssen, hätte das schwerwiegende Folgen für die beiden Länder, befürchtet Boutros: „Manche islamistische Einrichtungen warten schon darauf, in diese Lücke zu springen und die Kinder zu indoktrinieren. Weniger katholische Schulen bedeuten mehr Extremismus.“

Laut Boutros hätten die Lehrer aufgrund der hohen Inflation in Syrien und im Libanon oft nicht mehr als umgerechnet 30 Euro im Monat zur Verfügung: „Allein die Fahrt zur Arbeit frisst das ganze Gehalt auf.“ An vielen öffentlichen Schulen im Libanon seien die Lehrer deswegen in Streik getreten, so falle der Unterricht aus und Millionen Kinder drohten ohne Bildung aufzuwachsen. „Wir können viele von ihnen an den katholischen Schulen aufnehmen. Die Christen erfüllen hier eine wichtige Aufgabe. Die Kinder lernen die christlichen Werte kennen, und im Miteinander wächst auch die Toleranz.“
Auch die Unterstützung von „Kirche in Not“ zum Bau von Solaranlagen und die Sanierung der Schulgebäude sei sehr wichtig: „Das hilft den Schulen, autark zu werden.“

Im Libanon leben seit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes ab 2019 nach UN-Angaben rund 70 Prozent der Bevölkerung in extremer Armut, in Syrien sind es 90 Prozent. Dort hat der Krieg zu einem Rückgang der christlichen Bevölkerung um mehr als zwei Drittel geführt, heute leben schätzungsweise unter einer halben Million Christen in Syrien.
Auch im Libanon, das mit schätzungsweise 2,2 Millionen Gläubigen die zahlenmäßig größte christliche Gemeinschaft im Nahen Osten beherbergt, hält der Trend zur Auswanderung weiter an. Vor allem junge Familien verlassen das Land. Die katholischen Schulen und Bildungseinrichtungen setzen hier an und wollen junge Menschen Zukunftschancen in ihrer Heimat ermöglichen.
KIRCHE IN NOT hatte bereits 2022 Hilfsgelder für über 200 katholische Schulen im Libanon auf den Weg gebracht, um ihnen den Start nach den Sommerferien zu ermöglichen.
Empfänger: KIRCHE IN NOT
IBAN: AT71 2011 1827 6701 0600
Verwendungszweck: Libanon oder Syrien
Um den anhaltenden Exodus junger Menschen aus Syrien zu verhindern, bittet der syrisch-katholische Erzbischof von Homs, Julian Yacoub Mourad, um mehr Unterstützung für Schulen und Kulturangebote. „Wir sollten nicht nur Lebensmittel verteilen, sondern auch Projekte in Schulen, Kunst und Musik ins Leben rufen, damit die Menschen spüren, dass sie ein Recht auf Leben und Zukunft in Syrien haben.“ Mourad äußerte sich beim Besuch einer Delegation von KIRCHE IN NOT in Syrien.
Die schwierigen Verhältnisse im syrischen Schulwesen sieht er als eine der größten Herausforderungen für sein Land. „Die Ausbildung befindet sich in einer schweren und heiklen Krise“, sagte Mourad. Schüler und Lehrer hätten ein Recht auf ein gutes Arbeitsumfeld. Doch die Lehrergehälter lägen umgerechnet bei nur 18 bis 22 Euro im Monat – „unter der Menschenwürde“, beklagte der Bischof.
Auch die nach wie vor verhängten Sanktionen und die allgegenwärtige Korruption verstärkten die Auswanderungstendenzen: „Viele Familien haben die Hoffnung in dieses Land verloren und wollen nicht, dass ihre Kinder in einem Land aufwachsen, in dem sie nicht sicher sind.“ Zurückblieben meist ältere und hilfsbedürftige Menschen.

Priester und Bischöfe seien aktuell mehr denn je auf die Mitarbeit von engagierten Gläubigen angewiesen, um den Menschen beistehen zu können. Viele Seelsorger seien angesichts der vielen sozialen Aufgaben überlastet. „Wir müssen auch mehr die Jugendlichen einbinden. Sie haben neue und erfrischende Ideen, und wir brauchen sie, um die Zukunft zu gestalten“, betonte Erzbischof Mourad. Gleichzeitig sei es wichtig, die Menschen in ihrer Selbstverantwortung zu stärken, sonst bestehe die Gefahr, „dass die Menschen zu sehr von der Hilfe der Kirche abhängig werden“.
Mourad wurde im März 2023 zum syrisch-katholischen Erzbischof von Homs geweiht; mit seiner Weihe nahm er den Namen Julian Yacoub an, vorher war er unter seinem Geburtsnamen Jacques bekannt.

2015 war Mourad von Terroristen des „Islamischen Staates“ verschleppt und fünf Monate gefangen gehalten worden; sein Schicksal hatte international Aufmerksamkeit erregt. In seiner Geiselhaft habe er gelernt, dass Vergebung nicht „gemacht“ werden könne. „Vergebung bedeutet: Gott einen Platz in unserem Herzen vergeben, damit er in uns vergibt.“
Mourad berichtete, dass er in einem kleinen Badezimmer gefangen gehalten worden sei. Jedes Mal, wenn ein Terrorist den Raum betrat, habe er „nur Barmherzigkeit für diesen Menschen empfunden. Obwohl ich auch mit Wut und anderen starken Emotionen konfrontiert war, habe ich in diesem Augenblick keine solche Gefühle empfunden, sondern nur Barmherzigkeit.“
Es brauche Demut, um sich einzugestehen, dass der Mensch nicht von sich aus zu einer solchen Einstellung fähig sei, betonte der Bischof: „Alles, was wir können, kommt von Gott, auch die Vergebung.“
Empfänger: KIRCHE IN NOT
BIC: GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: Syrien
Im Zuge der jüngsten Großoffensive im Krieg zwischen Militärregierung und Rebellengruppen in Myanmar erhält KIRCHE IN NOT erschütternde Berichte von den katholischen Gemeinden im Land, berichtete die Geschäftsführende Präsidentin Regina Lynch: „In den vergangenen Tagen kam es zu einer erheblichen Eskalation von Gewalt und Vertreibung. Uns erreichen immer mehr dringende Gebetsaufrufe aus Myanmar. Das Leid hat mittlerweile einen kritischen Punkt erreicht.“
Immer mehr Zivilisten suchten in Kirchen Zuflucht, aber auch diese seien nicht sicher, berichtete Lynch: „Einige Kirchen sind selbst zu Konfliktzonen geworden; religiöse Einrichtungen wurden gewaltsam evakuiert. Es gibt Berichte von erschütternden Vorfällen.“
Auch seien kirchliche Einrichtungen bei den Kämpfen beschädigt worden, dies habe zu einer weiteren Verschlechterung der humanitären Situation geführt. In einer an KIRCHE IN NOT gerichtete Mitteilung aus Myanmar heißt es: „Die Situation ist katastrophal. Wir bitten alle, in diesen schwierigen Zeiten für uns zu beten.“

So wurde gerade erst ein katholisches Gemeindezentrum, das an die Kathedrale in Loikaw angeschlossen ist und wo seit Monaten für Binnenflüchtlinge, die vor den Auseinandersetzungen im Rahmen des anhaltenden Bürgerkriegs fliehen, Zuflucht suchen, wurde von der Armee angegriffen und besetzt. Dies berichtete Bischof Celso Ba Shwe von Loikaw, der Hauptstadt des Staates Kayah im Osten Myanmars. Auch heilige Stätten, so der Bischof, blieben von Militäroperationen nicht verschont, und das in einer Zeit, in der die Militärjunta mit der Kriegsführung vor Ort zu kämpfen habe.
“Die Armee hat dreimal versucht, den Komplex der Christ-König-Kathedrale einzunehmen“, berichtet er, „Als ortsansässiger Bischof habe ich zusammen mit den Priester versucht, die Militärgeneräle von der Bedeutung der religiösen Stätten zu überzeugen und sie gebeten, den Ort zu verschonen, an dem auch Vertriebene untergebracht sind. In der Nacht des 26. November feuerte das Militär jedoch mehrmals absichtlich Artilleriegranaten auf das Gemeindezentrum ab, wobei das Dach der Kapelle des Pastoralzentrums getroffen wurde. Die Decke wurde durch Artilleriegranaten zerstört. Aus Sicherheitsgründen haben wir in Absprache mit den Priestern beschlossen, das Pastoralzentrum zu verlassen. Kurz vor unserer Abreise gestern, am 27. November, kamen 50 Soldaten und besetzten das Gebäude, um es als Stützpunkt und Schutzraum zu nutzen“.

Regina Lynch erinnerte daran, dass in den vergangenen fast drei Jahren des Bürgerkriegs die Kirche den vertriebenen Menschen zur Seite gestanden sei. Doch angesichts der zahlreichen Konflikte weltweit fühlten sich viele Menschen in Myanmar alleingelassen. „Diese neue Spirale der Gewalt erfordert es, dass wir an unsere Brüder und Schwester in diesem oft vergessenen Teil der Welt erinnern. Unsere Solidarität und unser Gebet sind ein Leuchtfeuer in ihrer Dunkelheit.“
Die jüngsten Offensive nahm ihren Ausgang in der Provinz Shan-Staat. Internationalen Medienberichten zufolge sollen große Teile der Grenzregion zu China in der Hand der Oppositionstruppen sein. Die bewaffneten Gruppen nennen ihren koordinierten Angriff „Operation 1027″, da sie ihren Angriff am 27. Oktober gestartet haben.

Der Shan-Staat liegt im Osten Myanmars und umfasst annähernd ein Viertel der Gesamtfläche des Landes. Auch aus dem benachbarten Kayah-Staat und aus dem Chin-Staat im Westen des Landes werden erneute Kämpfe gemeldet. Die Offensive gilt als bislang schwerster Rückschlag für die Militärjunta nach der Machtübernahme im Februar 2021.
Nach Angaben des Berichts „Religionsfreiheit weltweit“ von KIRCHE IN NOT gehören von den rund 55 Millionen Einwohnern Myanmars rund acht Prozent einer christlichen Glaubensgemeinschaft an, die Zahl der Katholiken wird mit ein bis zwei Prozent angegeben.
Empfänger: KIRCHE IN NOT
IBAN: AT71 2011 1827 6701 0600
Verwendungszweck: Myanmar

Knapp zwei Drittel der Hilfen gehen nach Aleppo. Dort unterstützt KIRCHE IN NOT unter anderem ein Wohltätigkeitzentrum, in dem Lebensmittel und Dinge des alltäglichen Bedarfs an bedürftige Bewohner verteilt werden. In der Stadt befinden sich außerdem die Schule des armenisch-katholischen Mechitaristen-Ordens und das von der armenisch-apostolischen Kirche betriebene Karen-Jeppe-Kolleg. Sie wurden durch das Erdbeben beschädigt; KIRCHE IN NOT ermöglicht jetzt dringend notwendige Instandsetzungsmaßnahmen.
Weitere Projektgelder fließen in die Hafenstadt Latakia im Nordwesten Syriens. Dort hilft KIRCHE IN NOT bei Reparaturmaßnahmen an der griechisch-orthodoxen Kathedrale, einem katholisch-melkitischen Kloster und einer armenisch-apostolischen Kirche. Die Gotteshäuser sind auch wichtige Stützpunkte für das soziale Leben und die Versorgung mit karitativen Gütern.

„Wir haben mehrere Organisationen um Hilfe gebeten, und hatten das Glück, von KIRCHE IN NOT Unterstützung zu bekommen“, berichtet Michlen Mukel aus Aleppo. Das Wohnhaus, in dem sie mit ihrer Familie lebte, wurde beim Erdbeben schwer beschädigt. Sie gehörte zu den ersten Hilfeempfängern. Mittlerweile konnte in ihrem Haus das Dach repariert und mit Fundamentarbeiten begonnen werden. „Dank dieser Hilfe sind unsere Häuser jetzt winterfest“, sagt die Christin. „Ich bin allen, die zu diesem wichtigen Projekt beigetragen haben, sehr dankbar – vor allem den Spendern von KIRCHE IN NOT.“
Das Erdbeben vom 6. Februar 2023 war das stärkste in der Region seit über 80 Jahren. Die Zahl der bestätigten Todesopfer belief sich auf rund 60 000, die meisten von ihnen im Süden der Türkei. In Syrien starben rund 8500 Menschen, zehntausende wurden obdachlos.
Bitte helfen Sie den Menschen in Syrien, die aufgrund des Erdbebens immer noch zu leiden haben – online … hier oder auf folgendes Konto:
Empfänger: KIRCHE IN NOT
IBAN: AT71 2011 1827 6701 0600
Verwendungszweck: Syrien
Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Kardinal Pizzaballa, hat zu Gebet und internationaler Hilfe aufgerufen, um eine Deeskalation zu erreichen.
KIRCHE IN NOT schließt sich diesem Aufruf an. Wir sind in großer Sorge, zumal auch Nachbarstaaten wie der Libanon in den Sog der militärischen Auseinandersetzung geraten könnten.
Die Geschäftsführende Präsidentin von KIRCHE IN NOT (ACN), Regina Lynch, erklärte: „Wir teilen das Leid der Familien, die ihre Lieben verloren haben, und das Leid derer, die verletzt oder gefährdet sind. Wir beten zu Gott, dass er ihnen seinen Trost, seinen Mut und seine Hoffnung schenkt. Wir beten für die Heilung und den Trost aller, die unter Gewalt, Angst und Trauer leiden.“
Beten wir für alle Opfer, die politisch Verantwortlichen und alle Menschen im Heiligen Land.

Herr Jesus Christus,
du bist unser Friede (vgl. Eph 2,14) und das Licht der Völker.
Wir blicken mit Entsetzen auf das Meer von Gewalt, Hass und Tod im Heiligen Land.
Herr, erbarme Dich!
Nimm die Toten auf bei Dir.
Tröste die Menschen, die trauern, verwundet oder auf der Flucht sind.
Lass die entführten Menschen wieder sicher zu ihren Familien zurückkehren.Sei allen nahe, die voller Angst und Verzweiflung sind.
Herr, schau auf das Land, das Dir irdische Heimat war, und erbarme Dich.
Setze der Spirale aus Gewalt und Hass endlich ein Ende.
Lass Frieden und Gerechtigkeit aufblühen an den heiligen Stätten.
Lass die Menschen geborgen sein in Deinen Mauern.
Herr, gib Frieden im Heiligen Land und im ganzen Nahen Osten!
Du bist unsere Zuflucht.
Erbarme Dich unser und unserer Zeit.
Amen.